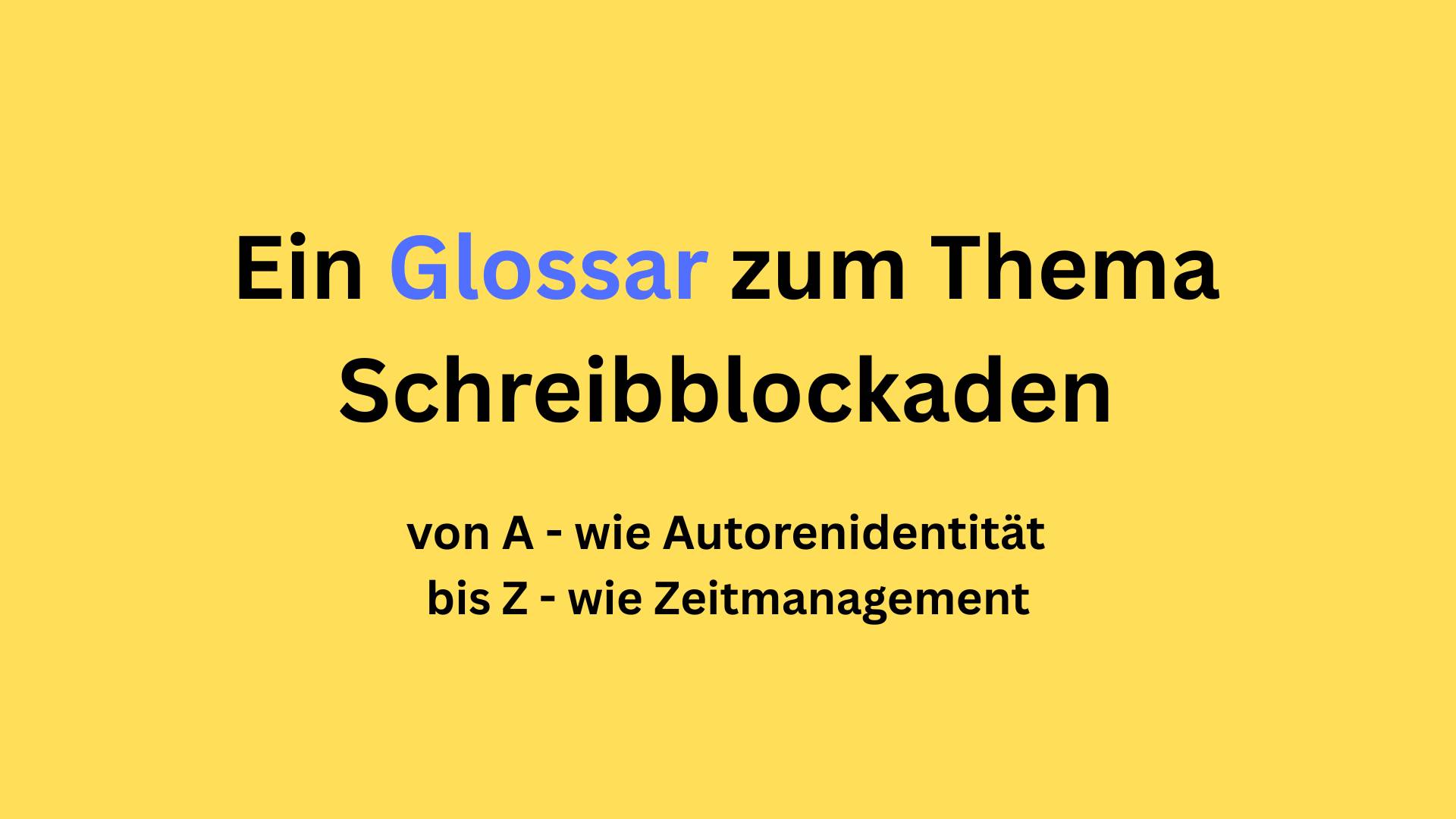Was steckt hinter einer Schreibblockade – wie lässt sie sich verstehen und lösen? Dieses Glossar bietet einen Überblick über die wichtigsten psychologischen, kreativen und organisatorischen Begriffe zum Thema Schreiben. Ein Nachschlagewerk für alle, die Schreibprozesse durchschauen, begleiten oder selbst wieder ins Schreiben finden wollen.
So funktioniert das Glossar
Hier findest du zentrale Begriffe zum Thema Schreibblockaden, von A – Z sortiert.
Vom Inhaltsverzeichnis aus kannst du direkt zu den Absätzen springen, die dich am meisten interessieren.
Auch innerhalb einzelner Definitionen sind Schlüsselworte verlinkt. So kannst du ohne Umwege zu weiteren Erklärungen springen und dich schnell informieren.
Angst (Schreibangst)
Ein zentraler emotionaler Faktor bei Schreibblockaden. Schreibangst entsteht oft durch Perfektionismus, Leistungsdruck, Angst vor Beurteilung oder negative Schreiberfahrungen. Angst kann zu Vermeidung, Ausweichmanövern, Prokrastinieren, Selbstkritik und sogar körperlichen Symptomen führen. Strategien zur Bewältigung von Schreibangst sind Entlastung, Erkennen der zugrundeliegenden Ursachen, positive Selbstgespräche und das Senken des eigenen Anspruchs.
→ Siehe auch: Perfektionismus, Innerer Zensor, Selbstmitgefühl.
Du steckst in einer akuten Schreibkrise?
Lies gern meinen ausführlichen Artikel über Schreibblockaden .
Oder schreib mir, wenn du Sofort-Hilfe benötigst.
Arbeitsvermeidung
Ein Verhaltensmuster, bei dem Schreibende (meist unbewusst) Tätigkeiten wählen, um das eigentliche Schreiben zu umgehen – z. B. exzessive Recherche, Aufräumen, Putzen oder Formatieren. Arbeitsvermeidung unterscheidet sich von bewussten Pausen dadurch, dass sie Stress kurzfristig reduziert, aber langfristig die Blockade verstärkt.
→ Verwandt mit: Prokrastination, Zeitmanagement.
Aufschieberitis / Aufschiebeverhalten
Synonym oder Teilaspekt von Prokrastination (vom lateinischen „procrastinare“, was „Aufschieben“, „auf Morgen verlegen“). Oft durch Angst, Überforderung oder fehlende Klarheit über die nächsten Arbeitsschritte ausgelöst. In der Schreibforschung wird betont, dass Aufschiebeverhalten meist kein Zeitproblem ist, sondern ein Problem der Emotionsregulation.
Autorenidentität
Bezeichnet das Selbstverständnis und die innere Haltung einer Person als Autor*in. Eine gefestigte Autorenidentität hat Vertrauen in die eigene Stimme und das eigene Schreibvermögen, und erleichtert somit das Überwinden von Blockaden. Probleme mit der Autorenidentität, z. B. Selbstzweifel und fehlende Erfahrung als Autor*in, verschärfen eine Schreibhemmung.
→ Verwandt mit: Schreibidentität
Autonomie
Das Gefühl, beim Schreiben selbstbestimmt zu handeln – also Inhalt, Stil und Tempo frei wählen zu können. Fehlt Autonomie (z. B. bei strengen Vorgaben oder starkem Erwartungsdruck), können negative Gefühle, Abwehrreaktionen und auch Blockaden entstehen. Eng verknüpft mit Autonomieerleben ist der Begriff der intrinsischen Motivation.
Belastungssymptome
Physische oder psychische Reaktionen, die mit wiederkehrenden oder längeren Schreibblockaden einhergehen – z. B. Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Gereiztheit, Tränenausbrüche, stressbedingter Gewichtsverlust, unerklärbare Schmerzen oder Erschöpfung. Sie weisen darauf hin, dass Betroffene überlastet sind und dass eine Pause, Beratung oder auch therapeutische Begleitung sinnvoll sein kann.
Bewertungssituation
Ein Auslöser für viele Schreibblockaden. Schreibende geraten besonders dann in Druck, wenn ein Text für die Öffentlichkeit geschrieben wird, als Leistungsnachweis dient oder Feedback erwartet wird. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Bewertung real ist oder nur befürchtet wird, also in der eigenen Fantasie stattfindet (Angst vor Kritik, Blamage, Hasskommentare). Didaktische Ansätze versuchen, Bewertungssituationen zu entdramatisieren – z. B. durch Zwischenfeedback oder Fokus auf den Prozess statt auf das Produkt. In Schreibgruppen oder nach tatsächlicher Publikation zeigt sich oft, dass Rückmeldungen viel positiver sind als befürchtet.
Blockadenarten
Schreibblockaden können unterschiedlich ausgeprägt sein:
- emotionale Blockaden (Angst, Sorge, Scham, Perfektionismus)
- kognitive Blockaden (Ideenleere, Überforderung, Wahrnehmungsverschiebungen)
- motivationale Blockaden (Langeweile, Desinteresse, Erschöpfung)
- situative Blockaden (äußere Ablenkung, technische Probleme, Zeitdruck
Um die passende Gegenstrategie zu einer akuten Schreibblockade wählen zu können, hilft ein genaues Hinhören und Hinspüren.
Blockadendynamik
Der Kreislauf aus Angst, Aufschieben, Schuldgefühlen und wachsendem Druck, der Schreibblockaden kennzeichnet und oft aufrechterhält. Wird dieser Teufelskreis erkannt, kann er unterbrochen werden. Hilfreich sind kleine Schritte, die zeitnah Erfolgserlebnisse produzieren, und die Einübung von wirksamen Schreibroutinen.
Brainstorming
Eine einfache, aber wirksame Methode zur Ideenfindung zu Beginn eines Projekts oder in der frühen Schreibphase. Es kann helfen, Blockaden durch strukturierte Sammlung von Ideen zu lösen. Ziel ist in kurzer Zeit möglichst viele Einfälle zu einem Thema zu sammeln, ohne diese zu bewerten. Wird Brainstorming mit einer weiteren Person oder in einer Gruppe angewandt, muss klar formuliert werden, dass Ideen zwar aufgegriffen und erweitert werden können, dass in dieser Phase aber keine Kritik erfolgt. Im Gegensatz zum Clustering erfolgt Brainstorming oft mündlich und gewonnene Ideen werden für die spätere Sortierung und Auswertung nicht-hierarchisch auf einer Liste festgehalten.
Clustering
Eine kreative Technik der Ideenfindung, bei der ein zentrales Wort in die Mitte eines Blattes geschrieben und von assoziativen Begriffen umkreist wird. Diese werden wiederum miteinander verbunden und können zu langen Ketten anwachsen. Die von Gabriele L. Rico entwickelte Methode des Kreativen Schreibens basiert auf der Annahme, dass kreative Gedanken durch bildhafte und nicht-lineare Strukturen leichter aktiviert werden. Besonders hilfreich ist die Clustering-Methode in der Orientierungs- und Planungsphase eines Schreibprojekts – oder bei einem Ideenstau.
→ Siehe auch: Freewriting, Schreibprozess
Flow
Ein Begriff aus der Motivationspsychologie, geht auf den ungarischen Psychologen Mihály Csíkszentmihályi zurück. Flow beschreibt einen sehr positiv erlebten mentalen Zustand völliger Konzentration, Verschmelzung und Vertiefung, in dem Herausforderungen und Fähigkeiten in Balance sind. Beim Schreiben äußert sich Flow in Leichtigkeit, Zufriedenheit, Zeitvergessenheit und hoher Produktivität. Schreibblockaden entstehen oft, wenn diese Balance gestört ist – z. B. durch Störungen, Überforderung oder Unterforderung.
→ siehe auch: Freewriting
Freewriting
Eine Methode des unvorbereiteten, spontanen, ununterbrochenen Schreibens ohne Korrektur oder Bewertung. Ziel ist es, innere Hemmungen zu lockern und Gedanken frei fließen zu lassen, do dass es zu einem Schreibflow kommt. Freewriting aktiviert unbewusste Assoziationen und eignet sich als Aufwärmübung oder zum Einstieg in komplexe Themen oder Schreibaufgaben. Freewriting wurde von Peter Elbow entwickelt und hat sich als höchst wirksame Methode des Kreativen Schreibens etabliert. Mit regelmäßigen und wiederkehrenden Freewriting-Einheiten können auch tiefer sitzende Schreibblockaden gelöst werden. Lies hier mehr über Freewriting.
Innerer Zensor / Innerer Kritiker
Bezeichnet die selbstkritische Stimme, die bereits während des Schreibens den entstehenden Text bewertet, abwertet oder Perfektion von der schreibenden Person verlangt. Der innere Kritiker spiegelt oft verinnerlichte Erwartungen, z. B. von Lehrkräften, Eltern oder einem Publikum wider. Um Blockaden zu lösen, ist es hilfreich, sich mit dieser inneren Stimme auseinander zu setzen, diese Stimme zu erkennen und Strategien zu entwickeln, den inneren Kritiker zu schwächen. Das gelingt, indem man Textproduktion und Textüberarbeitung als getrennte Arbeitsschritte behandelt. Der Schreibprozess braucht maximale Freiheit und Unbekümmertheit.
Korrektur
Korrekturen sind dazu da, geschriebene Texte zu verbessern. Beginnt die Korrektur zu früh, z. B. bereits während der Recherche- und Produktionsphase, hemmt sie den Schreibfluss und kann auch zu einer Schreibblockade führen. Um etwas zum Korrigieren zu haben, muss zunächst ein zusammenhängender Text entstehen. Im zweiten Schritt, findet die Überarbeitung statt. Dafür ist auch wieder die Einbeziehung des Inneren Kritikers sinnvoll.
Motivation
Die antreibende Kraft hinter dem Schreiben. Es gibt zwei Formen von Motivation. Intrinsische Motivation entsteht durch Interesse am Thema und Freude am Schreiben, extrinsische Motivation durch äußere Belohnung oder Druck. Studien zeigen, dass intrinsische Motivation mit höherer Schreibfreude und geringeren Blockaden einhergeht. Schreibdidaktische Ansätze zielen oft darauf, die innere Motivation zu klären und zu stärken. Mich inspirieren und motivieren unter anderem auch Zitate rund um das Thema Schreiben.
Perfektionismus
Vielleicht der größte Risikofaktor für Schreibblockaden. Er ist gekennzeichnet durch sehr hohe, überzogene Qualitätsansprüche und die Angst vor Fehlern. Perfektionismus kann dazu führen, dass Schreibende erst gar nicht beginnen zu schreiben oder ewig überarbeiten. Weil Vorbereitungen und vorhandene Texte nie gut genug sind. In meinen Schreibberatungen empfehle ich Strategien wie „Erlaube dir einen Rohtext“, „Schreibe in Etappen“, „5-Minuten-Texte schreiben“ und „Schreibe für die eigenen Augen“, um Druck zu mindern und ins Schreiben zu kommen.
Prokrastination
Das gewohnheitsmäßige, systematische Aufschieben von Schreibaufgaben, oft verbunden mit negativen Gefühlen und Selbstvorwürfen. Psychologisch gesehen ist Prokrastination ein Vermeidungsverhalten, das kurzfristig fühlbar Stress reduziert, langfristig aber Blockaden, Zeit- und Leistungsdruck verstärkt. Hilfreich sind Ansätze, mit denen Schreibende lernen, realistische Ziele zu setzen, ihre Zeit zu strukturieren und ihre Emotionen zu regulieren. Auch fix stehende Abgabetermine helfen manchmal Prokrastination zu reduzieren.
→ Verwandt mit: Zeitmanagement, Selbstwirksamkeit
Schreibberatung
Ein professionelles Unterstützungsformat, das Schreibende und Schreibwillige in allen Phasen des Schreibprozesses begleitet und zu neuer Autonomie führt. Berater*innen helfen, Blockaden zu erkennen, individuelle Strategien zu entwickeln, das eigene Schreiben zu reflektieren und das Schreiben positiv zu ritualisieren. Anbieter von Schreibberatungen sind Hochschulen, Schreibzentren, erfahrende Autor*innen, Journalist*innen, Schreibcoaches.
→ Verwandt mit: Schreibcoaching
Schreibblockade
Eine mehrdimensionale, für Betroffene oft schmerzhafte und manchmal langwierige Schreibhemmung: Gründe für Schreibblockaden können emotionaler (Angst, Überforderung), kognitiver (Ideenleere), motivationaler (Antriebslosigkeit) oder situativer (Zeitdruck) Art sein. Schreibblockaden sind ernstzunehmende Signale, dass im Schreibprozess etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Hilfreich ist die Diagnose der Ursachen und der gezielte Einsatz von Schreibtechniken, Reflexion und Entlastung. Ich finde: Auch Zeitmanagement-Strategien gehören in den Werkzeugkoffer von beruflich Schreibenden mit Blockaden.
Schreibcoaching
Ein individuelles, prozessorientiertes Begleitangebot über einen häufig längeren Zeitraum. In Ergänzung zur Schreibberatung bezieht Coaching häufig auch persönliche und berufliche Kontexte mit ein. Es verbindet Fachwissen, Zielarbeit, Motivation und Reflexion. Schreibcoaching ist besonders bei langfristigen Projekten (Master-Arbeiten, Dissertationen, Buchmanuskripten) effektiv. Es kann auch dabei helfen, Selbstmitgefühl zu entwickeln und den Wechsel zwischen Schreibprozess und Korrekturdurchgang einzuüben.
Schreibflow
→ siehe Flow
Schreibidentität
Das Selbstbild einer Person als Schreibende*r, das geprägt ist durch Vorbilder, Erfahrung, Feedback und Erfolgserlebnisse. Eine stabile Schreibidentität ist zeichnet sich durch Vertrauen in die eigene Schreibkompetenz und Resilienz gegenüber Kritik und Rückschlägen aus. Schreibblockaden treten häufiger auf, wenn die eigene Schreibidentität unsicher oder negativ geprägt ist. Schreiberfolge und erlebte Selbstwirksamkeit stärken die Schreibidentität.
→ Verwandt mit: Autorenidentität
Schreibprozess
Der Begriff „Schreibprozess“ umfasst das Planen, Formulieren, Überarbeiten und Überprüfen von Texten, also alle Stufen der Vorbereitung und Umsetzung bis zu einem fertigen Text. Nach Hayes & Flower (1980) handelt es sich um einen rekursiven, nichtlinearen Prozess. Schreibblockaden entstehen häufig, wenn Schreibende versuchen, alle Phasen gleichzeitig zu bewältigen (z. B. Anspruch an perfektes Schreiben schon im Entwurf). Mehr Informationen zu Schreibprozess-Modellen und zur Schreibforschung.
Schreibritual
Eine bewusst gewählte, wiederkehrende Handlung, die Sicherheit und Struktur für das Schreiben schafft – etwa ein bestimmter Schreibort, feste Schreibzeiten, immer gleiches Schreibmaterial oder Musik. Schreibrituale können einfach ein schöner, stimmungsvoller Auftakt im Sinne einer Zeremonie sein. Bei beruflich Schreibenden dienen die wiederkehrenden Abläufe der Konditionierung: Das Gehirn verknüpft das Ritual mit Schreibbereitschaft. Dadurch verkürzen sich Anlaufphasen und das Risiko für Schreibblockaden sinkt. Die Chancen für regelmäßige Flowerlebnisse steigen.
Schreibstrategien
Kombinationen aus Methoden, Gewohnheiten und Haltungen, mit denen Schreibende ihren Arbeitsprozess steuern. Typische Elemente sind Zeitplanung, Textgliederung, Ideentechniken oder mentale Strategien. Eine bewusste Strategieauswahl kann Schreibblockaden vorbeugen und Schreibfreude erhöhen. Bei Schreibhemmungen ist oft hilfreich, die eigenen Schreibstrategien zu hinterfragen und durch neue, für den aktuellen Moment wirksamere Schreibmethoden zu ergänzen. Wenn du gerade erst anfängst und noch keine Strategien besitzt, interessieren dich vielleicht meine 7 besten Tipps für Schreibanfänger.
→ Verwandt mit: Schreibritual, Schreibumgebung
Schreibtherapie
Ein Ansatz der Schreibforschung und Psychotherapie, bei dem Schreiben als Werkzeug zur emotionalen Entlastung und Verarbeitung genutzt wird. Schreibhemmungen gelten hier nicht als Defizit, sondern als Hinweis auf unbewusste Konflikte. Schreibtherapie nutzt regelmäßiges Schreiben als Mittel zur Selbsterforschung und Persönlichkeitsentwicklung bis hin zur Heilung. Eine weit verbreitete Methode ist „Expressives Schreiben“, die auf den US-amerikanischen Psychologen James Pennebaker zurückgeht.
Schreibumgebung
Die physische, soziale und mentale Umgebung, in der geschrieben wird. Faktoren wie Licht, Geräuschpegel, Temperatur, Sitzmöbel, Haltung oder digitale Ablenkung wirken unmittelbar auf Konzentration und Motivation. Schreibforschung zeigt: eine vertraute und stabile Umgebung reduziert Stress und unterstützt Kontinuität. Bei einer Schreibblockade können bewusste Änderungen am Arbeitsplatz, z. B. das Verschieben des Schreibtischs an einen angenehmer empfundenen Ort, den Neustart im Schreiben günstig beeinflussen. Auch ein Schreiben in Gemeinschaft kann eine Schreibhemmung lösen. Eine Übersicht über meine Schreibwerkstätten findest du hier.
Selbstmitgefühl
Die Fähigkeit, sich in schwierigen Schreibphasen mit Verständnis und Milde statt Härte zu begegnen. Studien (unter anderem von Kristin Neff, 2011) zeigen, dass Selbstmitgefühl mit höherer Motivation und geringerer Angst verbunden ist. Für Schreibende bedeutet das: Achtung vor Selbstvorwürfen bei Schreibblockaden. Es ist wichtig zu verinnerlichen, dass Fehler und Stocken Teil des Prozesses sind – keine persönlichen Defizite oder Zeichen von fehlendem Schreibtalent.
Selbstwirksamkeit
Vertrauen in die eigene Kompetenz, Herausforderungen bewältigen zu können. Schreibende mit hoher Selbstwirksamkeit und Autonomie beginnen Projekte leichter, halten länger durch, erzielen eher Erfolge und erleben seltener Blockaden. Der kanadische Psychologe Albert Bandura prägte den Begriff der Selbstwirksamkeit und gilt als Begründer der sozial-kognitiven Lerntheorie. Um Schreibende zu stärken, zielt die Schreibpädagogik auf Etappenziele im Schreiben und nutzt wertschätzendes, positives Feedback.
Überarbeitung
Ein bewusster Prozess, bei dem Rohtexte verbessert werden. Hierbei treten kreative assoziative, spielerische Persönlichkeitsanteile zurück, das analytische Denken übernimmt. Professionelle und erfolgreiche Schreiber*innen trennen klar zwischen Entwurfs- und Überarbeitungsphasen. Wer zu früh korrigiert, riskiert Blockaden, weil der kreative und der bewertende Modus kollidieren. Zur Überarbeitung sind auch kritische Stimmen wieder willkommen. Stichwort: Innerer Kritiker.
Zeitmanagement
Die bewusste Organisation von Schreibzeiten, Pausen und Zielen. Effektives Zeitmanagement verhindert Aufschiebeverhalten und Überforderung. Die Entscheidung für ablenkungsfreie Zeiten kombiniert mit Tools wie Zeitblöcke, Schreibtagebücher oder die Pomodoro-Technik fördern Regelmäßigkeit, machen Milestones erreichbar und senken Druck. Hier ist ein Link zu einem YouTube-Video über die Pomodoro-Technik.
Du steckst in einer akuten Schreibkrise?
Lies gern meinen ausführlichen Artikel über Schreibblockaden .
Oder schreib mir, wenn du Sofort-Hilfe benötigst.